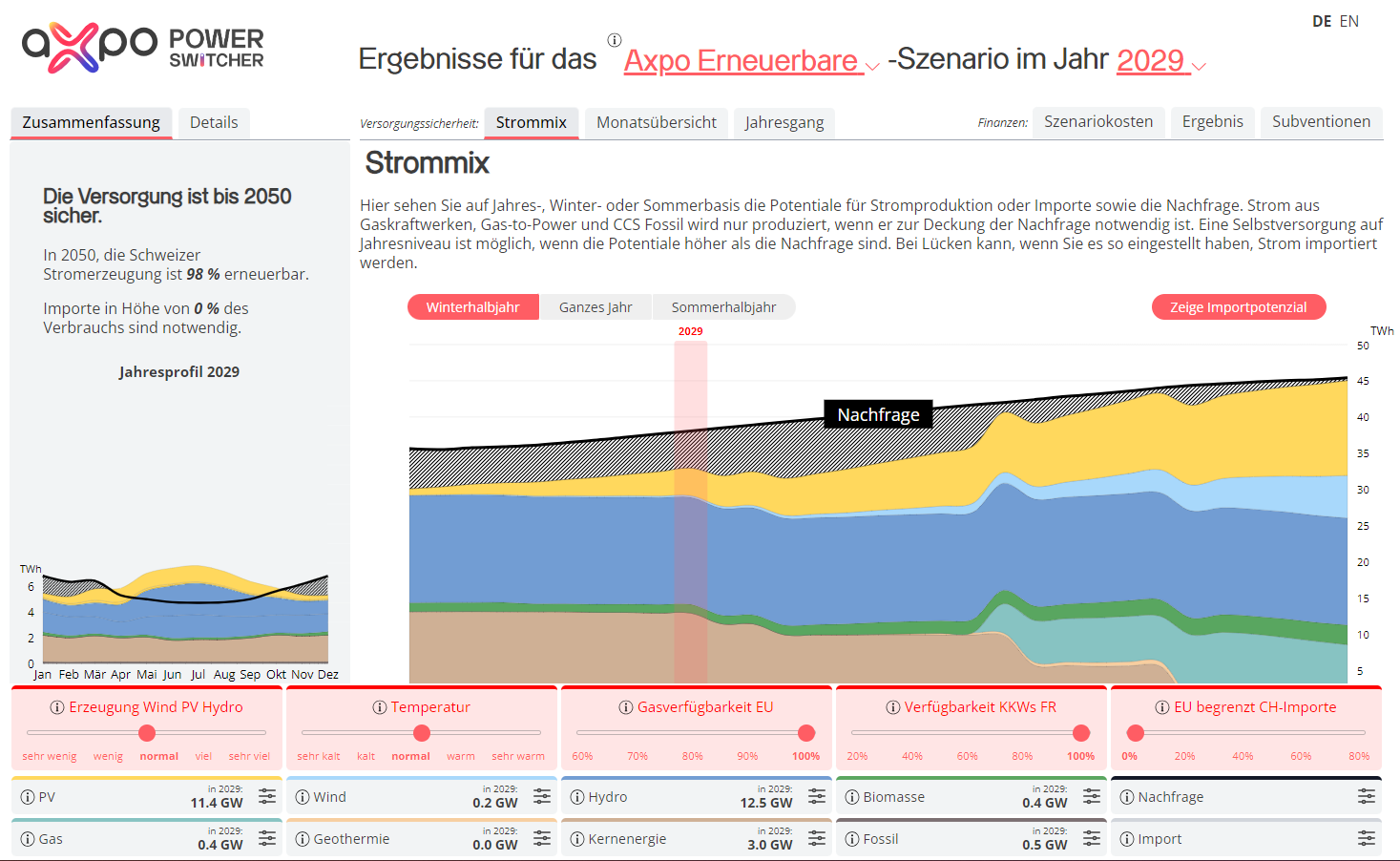21.08.2025 | Enormer Stromhunger der digitalen Zukunft
Was der Boom von KI und Rechenzentren für das Stromnetz bedeutet
Immer mehr Rechenzentren werden gebaut und an Stromnetze angeschlossen. Aktuell gibt es in der Schweiz rund hundert solcher Anlagen – mit rasant steigender Tendenz. Haupttreiber sind der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz, Cloud-Diensten und Streaming-Angeboten. Rechenzentren sind das Rückgrat der digitalen Welt – und echte Stromfresser. Sie benötigen so viel elektrische Leistung wie eine grössere Stadt – zum Beispiel wie St. Gallen mit 75 Megawatt.
Laut Experten hat sich der Stromverbrauch von Rechenzentren zwischen 2019 und 2024 fast verdoppelt: von 2.1 auf 4 Terrawattstunden. Auch Axpo spürt die steigende Zahl der Netzanschlüsse sowie die von Rechenzentren angefragten Strommengen. Wie wir als Verteilnetzbetreiber mit diesem Trend umgehen, was die technischen und wirtschaftlichen Hürden sind und wie Lösungen aussehen könnten, darüber sprechen wir mit unseren Netzspezialisten Leo Lowack, Leiter Strategisches Asset Management, und Philipp Schütt, Leiter Netzwirtschaft.
Datenzentren schiessen derzeit wie Pilze aus dem Boden. Was bedeutet dies für das Hochspannungsnetz der Axpo?
Leo: Als Netzbetreiber sind wir gemäss dem Stromversorgungsgesetz zur diskriminierungsfreien Gewährung der Netznutzung verpflichtet. Wir behandeln grundsätzlich alle Netzanschlussfragen gleich, bewerten und schliessen sie nach denselben Kriterien an unser Verteilnetz an. Selbstverständlich beeinflussen grosse Lasten den Lastfluss in unserem Netz. Jedoch erlauben wir Anschlüsse nur, wenn die geforderten Lasten mit der bestehenden oder geplanten Infrastruktur bedient werden können und die hohe Versorgungssicherheit im Axpo Netz gewährleistet bleibt.
Mit wem habt ihr es zu tun?
Philipp: Endverbraucher wie Rechenzentren binden wir grundsätzlich nicht direkt an unser Netz an, sondern werden bei unseren Partnern, den nachgelagerten Kantonswerken, angeschlossen. Die Leistung muss dennoch über das Axpo Netz bereitgestellt werden. In der Regel handelt es sich bei den Anschlussgesuchen um internationale Investoren. Sie bauen die Rechenzentren zur Bereitstellung von Cloud-Speichern und KI-Rechenkapazitäten. Nach der Inbetriebnahme wird die Rechenleistung vermietet.
Der Leistungsbedarf von Rechenzentren ist massiv gestiegen. Wie geht ihr damit um?
Leo: Leistungswerte über 50 MW oder sogar um 100 MW sind keine Seltenheit mehr. Damit können einzelne Rechenzentren mit dem Leistungsbedarf einer grösseren Schweizer Stadt mithalten (zum Vergleich: Die Last von St. Gallen mit rund 80’000 Einwohnern liegt bei 75 MW). Dies hat massive Auswirkungen auf unser Hochspannungsnetz. Deshalb erarbeiten wir kontinuierlich Massnahmen, um die vorhandenen Kapazitäten im Netz gezielt zu erweitern.
Mit welchen technischen Herausforderungen seid ihr konfrontiert?
Leo: Aus technischer Sicht stellt die Höhe der angefragten Leistung eine Herausforderung dar. Zum anderen steht hinter jeder Anfrage ein Business Case, bei dem Zeit eine entscheidende Rolle spielt. Die Genehmigungsprozesse in der Schweiz sind beispielsweise für neue Freileitungen dafür oft zu langsam. Es kam bereits vor, dass Anfragen zurückgezogen wurden, weil das prognostizierte Inbetriebnahmedatum zu spät war und den Business Case zunichte machte. Zudem hat die Zahl der Anfragen enorm zugenommen, was umfangreiche Studien und eine sorgfältige Koordination erfordert. Jede Zusage beeinflusst die verfügbare Netzkapazität anderer Verbraucher in der gesamten Region erheblich. Alle Datenzentren drängen darauf, möglichst schnell ans Netz zu gehen. Doch selbst nach erfolgtem Anschluss kann es Monate und Jahre dauern, bis die Rechenzentren ihre Leistung tatsächlich beziehen.
Stossen wir bei der Kapazität des Axpo Verteilnetzes bereits an Grenzen?
Leo: Unser Netzplanungsteam plant die Axpo Netze langfristig. Da Projekte zur Verstärkung der Infrastruktur viel Zeit benötigen, ist ein proaktives Vorgehen zur Gewährleistung einer soliden Versorgungssicherheit zwingend notwendig. Auf Basis des verbindlichen Szenariorahmens des Bundesamts für Energie haben wir sogenannte Zielnetze für die Jahre 2030 und 2040 entwickelt (siehe diesen Magazin-Artikel). Allerdings bildet der Szenariorahmen den aktuellen Trend zu mehr Rechenzentren nicht vollständig ab.
Das bedeutet?
Leo: Das bedeutet, dass wir Projekte zur Erhöhung der Netzkapazität für Rechenzentren erst bei verbindlicher Zusage für den entsprechenden Netzanschluss planen. Dabei suchen wir die volkswirtschaftlich effizienteste und damit für alle Stromverbraucher die kostengünstigste Lösung. Dazu sind wir in engem Austausch mit Swissgrid und den Kantonswerken. Axpo überprüft zur Zeit, wie wir strategisch auf die zunehmende Anzahl Grossverbraucher reagieren können.
Was tut ihr gegen Netzüberlastungen?
Leo: Um Netzüberlastungen zu vermeiden, planen wir unser Netz mithilfe von Redundanzen grundsätzlich ausfallsicher. Das bedeutet: Der Ausfall eines Elements beeinträchtigt die Versorgungssicherheit nicht. Dieses Prinzip halten wir auch beim Anschluss von Rechenzentren ein.
Seht ihr es als Vor- oder Nachteil, wenn Investoren ihre Rechenzentren im Axpo Netzgebiet ansiedeln?
Philipp: Rechenzentren sind aufgrund ihrer vergleichsweise konstanten und hohen Last ideale Kunden. Sie nutzen das Netz gleichmässig und zahlen für die Netznutzung. Herausfordernd ist die Lastprognose dieser Kunden, die oft unsicher und in der Netzauslegung herausfordernd ist. Grundsätzlich sehen wir niemals die tatsächlich bezogene Leistung der Rechenzentren, sondern lediglich die Gesamtleistung am Netzanschlusspunkt zum nachgelagerten Verteilnetz. Bei den Verteilnetzanschlüssen spielen auch die Einspeisungen und Verbräuche von Solaranlagen, Batterien, Haushalte und Industrien mit rein. Da Rechenzentren in unserem Netz oft mehr Leistung prognostizieren, als sie tatsächlich beziehen, setzen wir mit dem Netzkostenbeitrag Anreize für realistischere Prognosen.
Wer übernimmt die Kosten für den Netzanschluss, die Netznutzung und den Netzbetrieb?
Philipp: Die Kosten für den Netzanschluss übernimmt der Kunde einmalig über sogenannte Anschlussbeiträge, genauer gesagt: Netzanschluss- und Netzkostenbeitrag. Der Netzanschlussbeitrag entspricht den Kosten der Erstellung des Netzanschlusses selbst. Für das vorgelagerte Netz hat der Kunde einen Netzkostenbeitrag zu leisten. Danach werden ihm in Abhängigkeit seines Energiebezugs Netznutzungentgelte verrechnet.
Titelbild: CKW Datacenter in Zug (Symbolbild)
Rechenzentren
Jedes Mal, wenn wir eine Webseite aufrufen, einen Videostream starten, eine App nutzen oder ChatGPT befragen, laufen Datenströme im Hintergrund durch Rechenzentren. Dort werden Daten gespeichert, verarbeitet und rund um die Uhr verfügbar gemacht. Die Anlagen bestehen aus einer Vielzahl von Servern, Netzwerksystemen und der Kühltechnik – alles in hochsicheren Gebäuden, die auf maximale Ausfallsicherheit ausgelegt sind. Weil die Server im Dauerbetrieb laufen, ist der Strombedarf enorm – für den Betrieb, aber auch für die Kühlung. Rechenzentren sind daher nicht nur digitale Herzstücke, sondern auch Grossverbraucher im Stromnetz mit spezifischen Anforderungen an Versorgungssicherheit, Standortbedingungen und Anschlussleistung.




.jpg)