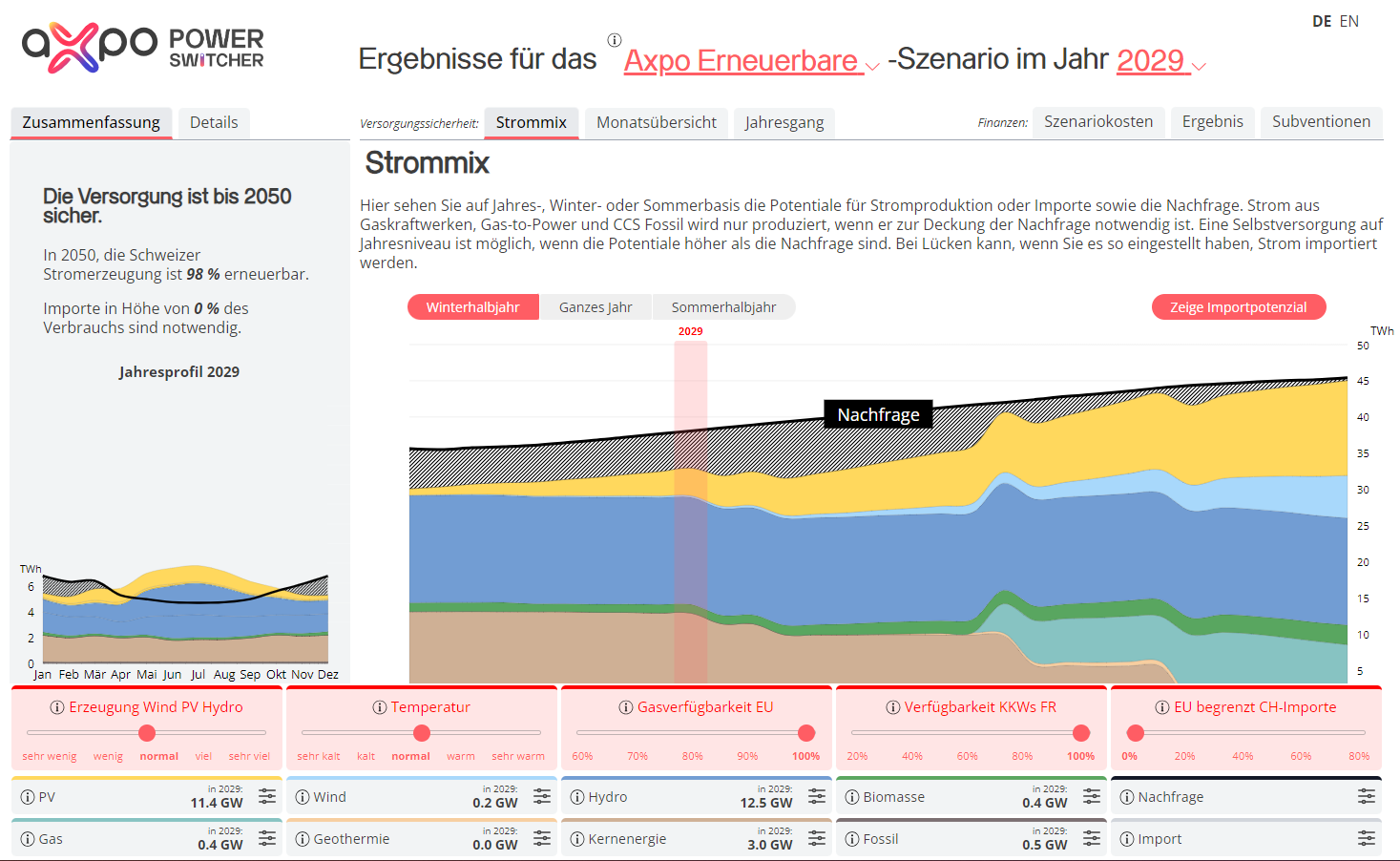01.10.2025 | Klimaschutz in der Europäischen Union
Paradigmenwechsel in der EU-Energiepolitik?
Das Energiedreieck der EU hat zum Ziel Versorgungssicherheit, liberalisierte Energiemärkte und Nachhaltigkeit dauerhaft in Einklang zu bringen. Während der EU-Legislaturperiode 2019–2024 stand die Erreichung der Klimaneutralität bis 2050 durch den «European Green Deal” ganz oben auf der Agenda, zu Lasten der beiden anderen Ziele. Aktuelle geopolitische Entwicklungen und die Wiederwahl von Donald Trump haben einen Paradigmenwechsel in der globalen Energiepolitik ausgelöst, der nicht ohne Auswirkungen auf die EU-Energie- und Klimapolitik bleiben dürfte. Eine Einschätzung.
Das EU-Energiedreieck, welches auch häufig “Energietrilemma” genannt wird hat ein ausgewogenes Verhältnis von Versorgungssicherheit, liberalisierte Energiemärkte und Nachhaltigkeit zum Ziel. In der Praxis sind die jeweiligen politischen Prioritäten jedoch permanent im Wandel. Die Gaskrise nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine zwang Brüssel dazu, die Versorgungssicherheit wieder in den Vordergrund zu rücken, während die Verbraucher Entlastung von steigenden Preisen fordern. Nachhaltigkeit steht zwar nach wie vor im Mittelpunkt der EU, doch es mehren sich Signale für einen Kurswechsel: Zunehmende LNG-Importe aus den Vereinigten Staaten oder Diskussionen rund um die Laufzeitverlängerung für Reservekohlekraftwerke sind Beispiele dafür.
Paradigmenwechsel: Die Widerwahl Donald Trumps
Donald Trumps Rückkehr ins Weisse Haus hat das politische Establishment in Europa erschüttert. In seiner ersten Amtszeit hat er die US-Energiemärkte durch Deregulierung, Unterstützung der heimischen fossilen Energieträger und insbesondere LNG-Exporten, neu gestaltet. Die zweite Trump-Regierung setzt diese Strategie fort: Die Vereinigten Staaten haben das Pariser Klimaschutzabkommen gekündigt und sind bestrebt, die militärische Abhängigkeit der Europäer (und anderer Staaten) durch den Ausbau ihrer energiepolitischen Dominanz im Öl-, Gas- und Nuklearsektor zu monetarisieren. Am 29. September 2025 kündigte der US-Energieminister Chris Wright sogar Subventionen in Höhe von 625 Millionen US-Dollar zugunsten der US-Kohleindustrie an. Für rote Köpfe in der EU sorgte die im Juli 2025 in Turnberry erfolgte Einigung in Handelssachen mit den Vereinigten Staaten; u. a. versprach EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, bis 2028 US-Energieprodukte (LNG, Erdöl, Nukleartechnologie) im Wert von 750 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Für Europa bedeutet dies sowohl Chancen als auch Risiken: US-LNG kann den Ausstieg aus russischen Erdgaslieferungen erleichtern, schafft aber zugleich neue Abhängigkeiten.
Geopolitischer Wandel
Auch im Rest der Welt zeichnen sich grundlegende Veränderungen ab: China hat sich langfristige LNG-Verträge mit Katar und den USA gesichert und damit seine Lieferanten diversifiziert. Für Aufsehen sorgte zudem eine im September 2025 veröffentlichte Einigung mit Russland zu Erdgaslieferungen aus Sibirien. Mit dem Wegfall der jahrzehntelang stabilen Lieferungen aus Russland ist Europa jetzt mehr denn je der Volatilität des globalen LNG-Marktes ausgesetzt. Afrika, Wunsch-Partner der Europäer für die Energiewende, strebt nach neuen Partnerschaften wie z. B. dem Zusammenschluss der BRICS-Staaten. Der Nahe Osten bleibt wichtiger Energie-Lieferant und ist zugleich Quelle der Instabilität. Europa verliert geopolitisch an Bedeutung; zugleich scheint eine stärkere Bündelung von Ressourcen und Verhandlungsmacht auf EU-Ebene unter EU-Bürgern an Attraktivität zu verlieren.
Russland–Ukraine
Die rasche Reduzierung der russischen Gasimporte durch Europa – von 40 % der Gesamtversorgung im Jahr 2021 auf etwa 13 % im Jahr 2025 – ist eine aussergewöhnliche Leistung. Allerdings beziehen die EU-Mitgliedsstaaten weiterhin russisches Pipelinegas, z. B. über die Türkei, und russisches LNG wird nach wie vor in LNG-Terminals in der EU angelandet. Im Juni 2025 hat die Europäische Kommission einen Gesetzesvorschlag vorgelegt, um den Import von russischem Gas bis 2027 endgültig zu beenden. Die wegfallenden Mengen sollen durch Energieeffizienzmassnahmen und alternative Lieferinfrastruktur in Verbindung mit alternativen Lieferanten ausgeglichen werden. Wirtschaftlich gesehen hat das Verbot seinen Preis: LNG aus den USA und Katar ist teurer und nicht ohne politische Risiken.
Iran–Israel
Die Eskalation zwischen dem Iran und Israel im Juni 2025 hat erneut gezeigt, wie fragil die globalen Energieflüsse sind. Die Öl- und LNG-Preise reagierten weniger auf tatsächliche Engpässe als auf das Risiko derselben. Eine Sperrung der Strasse von Hormus oder – in geringerem Umfang - erneute Angriffe der Houthis auf Schiffe in der Meerenge von Bab al-Mandab könnten eine weitere Krise auslösen. Auch wenn die direkten Importe aus der Region für Europa weniger wichtig sind als für den asiatischen Markt, ist Europa den globalen Preisschwankungen ausgesetzt. Umso wichtiger ist ein gutes Risikomanagement. Dies durch diversifizierte Verträge, flexible Routen, stärkere Sicherheit kritischer Infrastrukturen und verbesserte Marktanalysen die auch geopolitische Faktoren miteinschliessen.
Chris Wright vs. Dan Jørgensen
Zwei sehr unterschiedliche Visionen der Energiepolitik trafen am 11. September in Brüssel aufeinander, um die Energiebeziehungen zwischen der EU und den USA zu diskutieren: der ehemalige Energieunternehmer und Energieexperte Chris Wright und aktueller US-Energieminister, und der ehemalige dänische Klimaminister Dan Jørgensen, jetzt aktueller EU-Energiekommissar. Für Wright ist preiswerte fossile Energien sowohl die Grundlage für den Wohlstand der Vereinigten Staaten und der Welt und deren Export die Grundlage für die sogenannte strategische Energiedominanz der USA. Jørgensen sieht die Europäische Union weiterhin in eine Führungsrolle im globalen Klimaschutz. Zugleich ist er mit den sozial- und industriepolitischen Herausforderungen steigender Energiekosten in der EU konfrontiert. Zunehmende wird das Verhältnis von Wettbewerbsfähigkeit und Klimaschutz in den EU-Mitgliedsstaaten hinterfragt. Verschärfend kommt hinzu, dass Wright den Europäern vorwirft, dass es sich beim EU-Klimaschutz um verkappte Marktabschottungsmassnahmen zulasten der US-Industrie handelt, und dass die EU-Klimaziele die EU wirtschaftlich schwächen, und zwar in Zeiten, in denen die Vereinigten Staaten auf eine starke europäische (Rüstungs)industrie angewiesen sind.
Mario Draghi 2.0
In seinem Bericht über die Wettbewerbsfähigkeit Europas hebt Mario Draghis die Energiekosten als kritische Schwachstelle hervor. Während seine Analyse in weiten Teilen richtig liegt, zieht er – und seine Co-Autoren - leider die falschen Schlüsse im Hinblick auf die erforderlichen Massnahmen in der EU: Mittels Eingriffe in den Grosshandels-Markt sollen die erwünschten Energiepreise herbeireguliert werden. Mario Draghi hat zwar insofern Recht, dass hohe Energiekosten die europäische Industrie schwächen bzw. abwandern lassen, aber die Antwort darauf sind weder Markteingriffe auf EU- noch auf nationaler Ebene. Stattdessen sollte die EU an einer ihrer wichtigsten Erfolgsgeschichten festhalten: dem EU-Binnenmarkt für Strom, der auf grenzüberschreitendem Handel und der Preisfestsetzung mittels Grenzpreis beruht.
EU-Treibhausgasminderungs-Ziel für 2040?
Aufgrund der sich eintrübenden wirtschaftlichen Aussichten erscheint das ursprüngliche Ziel der Europäischen Kommission, die Treibhausgasemissionen bis 2040 um 90 % zu reduzieren, kein Selbstläufer mehr. Und das, obwohl die Europäische Kommission vorgeschlagen hat, bis zu 3 % der Minderungen über internationale Emissionszertifikate zu erreichen. Der entsprechende EU-Gesetzgebungsprozess stockt sowohl im Europäischen Parlament als auch im Rat. Auf Initiative Frankreichs hin sollen die EU-Staats- und Regierungschefs am 23. und 24. Oktober eine politische Lösung finden.
Fazit
Jahrelang stand in der EU die Klimapolitik zu Oberst auf der Agenda. Trumps Wiederwahl, eine sich wandelnde geopolitische Lage und der Krieg in der Ukraine zwingen die EU der Versorgungssicherheit und der Wettbewerbsfähigkeit mehr Bedeutung beizumessen. Andernfalls droht eine fortschreitende De-Industrialisierung bei gleichzeitiger aussenpolitischer Irrelevanz.




.jpg)